Digitales Programmheft zu:
The Telephone / Il combattimento
Doppelabend von Gian Carlo Menotti / Claudio Monteverdi:
Regisseur Kilian Bohnensack über die Inszenierung:
Der junge Regisseur Kilian Bohnensack zeigt mit dieser Inszenierung erstmals eine Arbeit am Staatstheater Wiesbaden. Er hat bislang Film gemacht, Theater für Kinder und Jugendliche an der Münchener Schauburg inszeniert und ist seit der Spielzeit 2024/25 am Staatstheater Wiesbaden als Regieassistent engagiert. Eine besondere Leidenschaft hegt er für das Lichtdesign im Theater. In Menottis „The Telephone“ und Monteverdis „Combattimento“ sieht er zwei Erzählungen über menschliche Ferne und Nähe:
Gewalt ist in der heutigen dauervernetzten Welt jederzeit sichtbar zu machen. Es reicht aus, auf ein soziales Netzwerk zu gehen. Gewalt ist dort auf Abruf erfahrbar. Wir können auf der Toilette sitzen und zuschauen, wie Menschen enthauptet und ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht werden. Gleichzeitig ist meine Generation in Europa so gewaltfrei aufgewachsen wie keine Generation vor ihr. Alltagsgewalt wie die Prügelstrafe in Schulen gibt es nicht mehr. Wir haben keine kollektiven Gewalterfahrungen gemacht, wie sie zum Beispiel vor hundert Jahren in der Zwischenkriegszeit tief in der Gesellschaft verankert waren. Gleichzeitig gibt es jetzt gerade eine wiederaufflammende „Wehrhaftigkeits“-Debatte. Was bedeutet es, wenn wir als die gewaltfreie Generation plötzlich mit für uns abstrakten Begriffen wie Kriegstüchtigkeit und Zeitenwende konfrontiert sind? Gehen wir damit naiv um, wie in dieser Inszenierung Ben („The Telephone“), nur um in den Abgrund gerissen zu werden? „The Telephone“ spielt in der Zivilisation und im Noch-Frieden, „Il combattimento“ im Krieg. Zwei auf den ersten Blick totale Gegensätze, doch: „Jeder Krieg wird in Frieden vorbereitet – und jeder Frieden ist Folge eines Krieges“, so Ole Nymoen, der 1998 geborene Autor des Buches „Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde“.
Text: Kilian Bohnensack
Über den Opern-Doppelabend
von Katja Leclerc
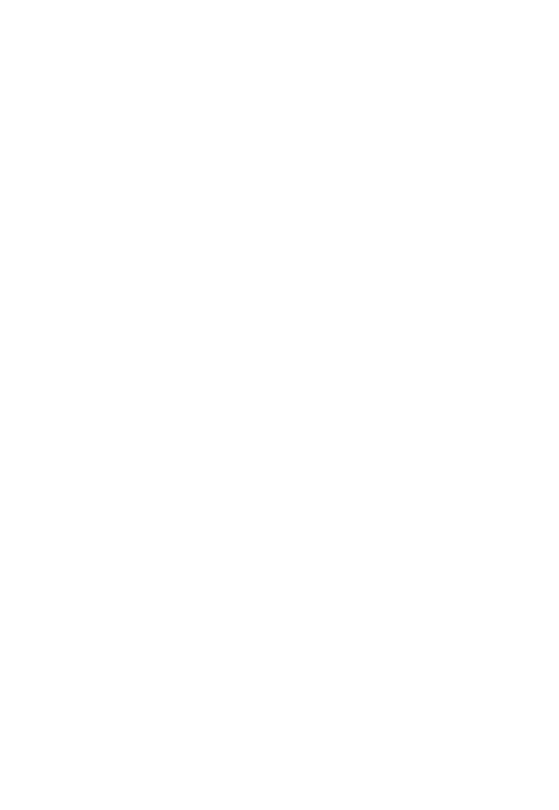
Cover der Partitur von „The Telephone“ von Gian Carlo Menotti
Zwei Stücke zu kombinieren, setzt fantastische Verbindungen zwischen ihnen frei. In diesem Doppelabend, der in der Regie von Kilian Bohnensack zu einem einzigen Theaterstück verschmilzt, beobachten wir zwei Paarkonstellationen: In „The Telephone“ will Ben Lucy unbedingt noch etwas mitteilen, bevor er gehen muss, doch das Klingeln des Telefons unterbricht permanent ihr Gespräch. Wir hören nur die eine Gesprächsseite der Anrufe und beobachten Ben beim stillen Betrachten seiner telefonierenden Freundin. Fragen kommen auf: Scheint Lucy froh darüber zu sein, dass sie der Situation entfliehen kann? Was treibt Ben zu seiner dringenden Mitteilung, die ein Heiratsantrag sein könnte, oder ein letztes Wort? Unter der leichten Konversationsoberfläche der kurzen Oper schwelen Ängste und Konflikte. Menotti schrieb sie 1947 als komödiantisches Vorspiel für den Opern-Thriller „The Medium“, und sie lief im Unterhaltungs-Mekka Broadway lange erfolgreich. Überhaupt haben wir es mit Menotti – wie auch mit Monteverdi – mit zwei Musiktheater-Erfindern zu tun.
Ich glaube, Musik ist unvermeidlich. Man erfindet sie nicht. Man findet sie.Gian Carlo Menotti
Bei Menotti sind es neuartige, kurze Opern für kleinere (Boulevard-)Theater und Fernseh-Opern, mit denen er ein breites Publikum erreichte und auf kreative Weise neues Musiktheater für neue Medien schuf. Monteverdis Erfindungen bilden überhaupt den Anfang der Oper, wie wir sie heute kennen. So muss man sich seine Madrigale und musikalischen Szenen als freie Versuche im Spiel mit Text, Szene, Tanz, Gesang und neuen Spieltechniken für Instrumente vorstellen…
In Tassos Erzählung fand ich die gegensätzlichen Leidenschaften wieder, die ich dem Gesang anvertrauen wollte: neben dem Krieg auch das Gebet und den Tod.Claudio Monteverdi
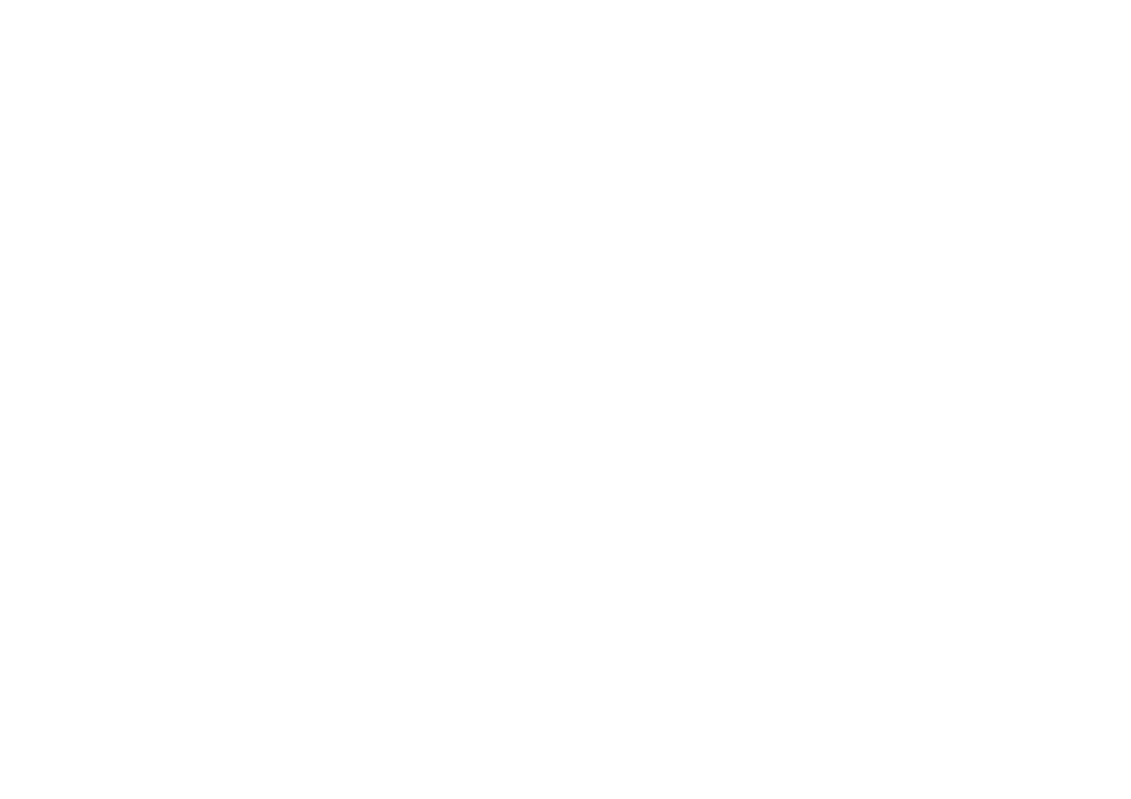
Titelblatt von Monteverdis Madrigalbuch „Guerrieri et amorosi“
In „Il combattimento di Tancredi et Clorinda“ kämpfen zwei Liebende mit Waffen gegeneinander – unerkannt, da sie in Kampfausrüstung auf gegnerischen Seiten im Glaubenskrieg stehen. Monteverdi erfand mit diesem und anderen Madrigalen im 16. Jahrhundert eine gänzlich neue Musik für zuvor nie dargestellte Leidenschaften, die er „concitato” nennt: aufgeregt, lebhaft. Hier tauchen zum ersten Mal Notenwiederholungen als Ausdrucksmittel für diese Erregung auf. Der Rhythmus und die Wahl der Töne geben plastischen Eindruck von den schweren Schritten der Kämpfenden, von den heftigen Hieben der Waffen, von den lauernden Ruhephasen und von lautmalerischer Natur, wie dem Bächlein, aus dem Tancredi das Wasser für Clorindas christliche Taufe schöpft. Doch verhindert ein Erzähler das absolute Einfühlen in die kämpfenden Charaktere. Dieser „testo“ (Zeuge) gibt den Hauptanteil des Textes von Torquato Tasso wieder, mit so manchem Verfremdungseffekt: Zum Beispiel verweist er auf den Kunstwert der Kampfszene als „eines vollen Theaters würdig“. Die wenigen Worte, die Tancredi und die durch sein Schwert getroffene, zu seinem größten Schmerz sterbende Clorinda direkt zueinander sagen – singen –, rühren umso unmittelbarer an unser Gefühl.
Gian Carlo Menotti im Porträt:
Gian Carlo Menotti war zu Lebzeiten einer der populärsten Komponisten. In mehreren Fernsehinterviews stand er Rede und Antwort und zog Bilanz über sein Lebenswerk. Dabei zeigt er sich als ebenso selbstkritischer wie lebenskluger Gesprächspartner, der seine Kunst vor allem der Großzügigkeit Gottes zuschreibt. Im Jahr 2000, sieben Jahre vor seinem Tod, widmete ihm die Reihe „BBC Music Masters“ ein ausführliches Porträt.
Youtube-Video aus dem BBC Archiv über Gian Carlo Menotti
Monteverdis Musik entschlüsseln:
Das Wissen um die Musik des Barock und der frühen Neuzeit war lange lückenhaft. Der Musiker und Dirigent Nikolaus Harnoncourt leistete Pionierarbeit in der Erforschung von Alter Musik. Dabei blieb er stets neugierig, interessierte sich mehr für neue Fragen als althergebrachte Antworten. Kann man sich die Musik von Monteverdi wie Oper heute vorstellen? Wie klangen die Instrumente damals? Und wie ist der oft spärliche Notentext genau zu verstehen? Der Podcast „Harnoncourts Klangreden“ präsentiert Mitschnitte von Vorträgen aus den 1970er Jahren über die Sprache und Aufführungspraxis der Alten Musik. Darin geht es auch konkret um „Il combattimento di Tancredi et Clorinda“.
Hallo, hallo? Über das Telefon:
Wenn es um die Erfindung des Telefons geht, sprechen viele zuerst von dem gebürtigen Schotten Alexander Graham Bell. Das mag daran liegen, dass er seine Erfindung gut zu patentieren wusste. Doch der erste Versuch mit der Übertragung der menschlichen Stimme über große Entfernungen mithilfe von Elektrizität fand ganz in der Nähe von Wiesbaden statt: Johann Philipp Reis aus Gelnhausen gelang es als Erstem, Sprache über ein Telefon zu übertragen. Und von ihm stammt auch der legendäre Satz: „Das Pferd frisst keinen Kartoffelsalat“ …