Digitales Programmheft zu
La traviata:
Oper von Giuseppe Verdi
Im Licht der Empathie:
Das „La traviata“-Team im Gespräch mit Dramaturgin Hanna Kneißler:
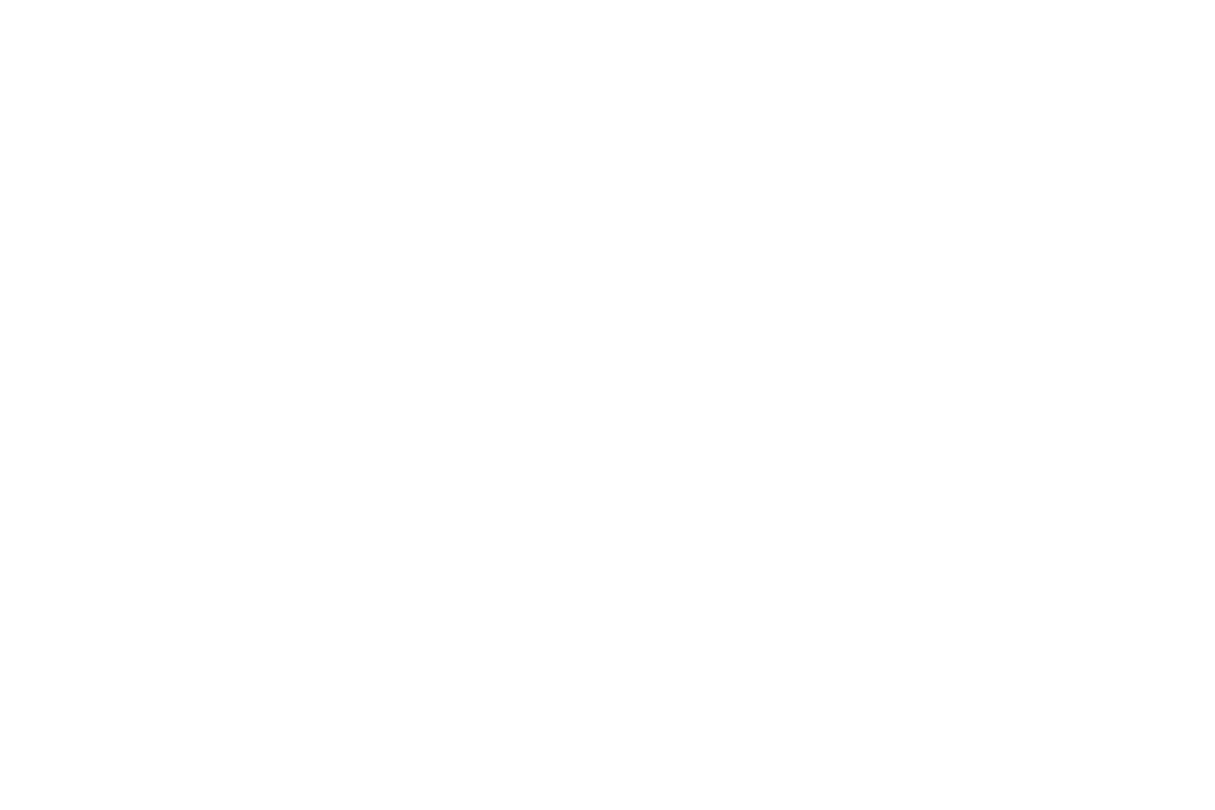
In „La traviata“ liegen Gegensätze nahe beieinander: öffentliche und private Räume, äußere Umstände
und tiefliegende Gefühle. Wie seht ihr diese verschiedenen Sphären?
und tiefliegende Gefühle. Wie seht ihr diese verschiedenen Sphären?
Tom Goossens: Wir begegnen einer Pariser Partygesellschaft, die alles tut, um ihre glänzende Oberfläche zu wahren. Hier liegt die Aufmerksamkeit auf äußerer Schönheit und leicht Konsumierbarem – Drinks, Körper. Tiefe Gefühle haben keinen Platz. Wir erleben, wie Violetta gegenüber dieser Gesellschaft ganz anders auftritt, als wenn sie mit Alfredo allein ist. Er hatte sich auch für sie interessiert, als sie krank war und nicht am Partyleben teilnehmen konnte. So merkt sie, dass in ihr eine innere Schönheit und empathische Liebe steckt, die sie gemeinsam mit Alfredo neu entdecken und ausleben kann.
Myriam Lifka: Das Wechseln zwischen verschiedenen Welten kennt vermutlich jeder Mensch. Wenn es bei uns auch nicht so extrem geschieht wie bei Violetta, verhalten wir uns doch im Beruf, in der Familie, unter Freund*innen immer anders – und fühlen auch anders. Das finde ich grundlegend menschlich.
Bart Van Merode: Wir zeigen die kontrastreichen Räume durch unterschiedliches Licht. Das pinke Partylicht nutzt Filter, also eine Folie zwischen Lichtquelle und den Menschen; das andere ist reines, helles Licht, was die Figuren so erscheinen lässt, wie sie sind. Wir verstehen es symbolisch für eine ständige Verstellung oder eben ehrliche Anerkennung – je nach Umgebung. Das helle Licht scheint aus Violetta selbst zu kommen; sie kann es auf andere Menschen richten.
Was kann es in dieser Inszenierung bedeuten, jemanden in ein bestimmtes Licht zu rücken?
Tom Goossens: Alle Beteiligten stehen buchstäblich ‚im Rampenlicht‘, weil sie Teil eines Spiels sind. Wir haben eine Bühne auf der Bühne – ein Podest, teilweise mit einem pinken Teppich. Wer sich darauf bewegt, ‚performt‘ vor den anderen. Violetta ist sehr häufig auf dieser Bühne und wird dabei vom Chor, der schaulustigen Gesellschaft, beobachtet – bis in die privatesten Momente hinein. Ich finde, diese permanente öffentliche Aufmerksamkeit auf das Individuum ist auch ein Phänomen unserer Zeit: Dem Druck, ein Bild von uns selbst zu inszenieren, können wir kaum entkommen – ebenso wenig wie Violetta. Letztlich stirbt sie auch durch diesen (Leistungs-)Druck.
Bart Van Merode: Das Theaterpublikum bildet die vierte Seite der schauenden Menge um das Podest herum; so korrespondiert das Thema mit der Situation am Abend. Wir können uns fragen lassen: Warum schauen wir immer wieder gerne zu, wie eine Frau auf einer Opernbühne stirbt? Außerdem wird Theater hier auf das Wesentlichste reduziert, um sein Inneres freizulegen: eine Plattform und Menschen im Licht.
Ist die Konzentration auf einen Kern auch ein Merkmal der Komposition?
Leo McFall: Absolut. Was ich an Verdi am meisten liebe, ist die Ökonomie seines Ausdrucks. In dieser Oper gibt es keine einzige „überflüssige Note“; alles, was er geschrieben hat, dient dem Drama und verstärkt es. Ein Beispiel: In ihrer ersten Arie singt Violetta „a diletti sempre nuovi dee volare il mio pensier” („Meine Gedanken müssen immer neuen Vergnügungen entgegenfliegen“). Wie hat Verdi dies vertont? Genau auf das Wort „volare” – fliegen – schreibt er eine sehr ausdrucksstarke, absteigende (!) Melodie. Mit dieser einfachen Geste deutet er bereits im 1. Akt an, dass Violetta – trotz ihres Optimismus‘ in diesem Moment – kein glückliches Leben beschieden sein wird.
Das gesamte Interview können Sie im gedruckten Programmheft lesen.
Grey Gardens:
Der Film „Grey Gardens“ (1975) von Albert und David Maysles, Ellen Hovde und Muffie Meyer war Inspirationsquelle der Produktion für die Darstellung der Pariser Gesellschaft – besonders für deren Kostüme. Kostümbildnerinnen Sietske Van Aerde und Lena Mariën:
„Für das Styling der Figuren ließen wir uns von dem Dokumentarfilm ‚Grey Gardens‘ der Maysles-Brüder inspirieren. Der Film porträtiert eine Tante und eine Cousine von Jackie Kennedy – zwei Frauen einer wohlhabenden Familie, die zusammen in einer Villa in einem vornehmen Viertel außerhalb von New York leben. Im Laufe der Jahrzehnte wurden sie geistig und körperlich zunehmend von der Gesellschaft entfremdet. Ihr Haus verfiel; sie leben zwischen Müll und streunenden Katzen, erwarten aber dennoch, dass das Beste noch vor ihnen liegt und bereiten sich jeden Tag auf hochrangige Gäste vor. Umgeben von den Resten ihrer reichen und wilden Vergangenheit, bemühen sich die Frauen, immer noch begehrenswert auszusehen. Sie entfliehen der Realität und legen bei ihrer Kleidungsauswahl und -zusammenstellung große Kreativität an den Tag. Ihr Handeln hat uns tief beeindruckt. Wir wollten, dass jede Figur in „La traviata“ zu einer einzigartigen Collage wird.
„Für das Styling der Figuren ließen wir uns von dem Dokumentarfilm ‚Grey Gardens‘ der Maysles-Brüder inspirieren. Der Film porträtiert eine Tante und eine Cousine von Jackie Kennedy – zwei Frauen einer wohlhabenden Familie, die zusammen in einer Villa in einem vornehmen Viertel außerhalb von New York leben. Im Laufe der Jahrzehnte wurden sie geistig und körperlich zunehmend von der Gesellschaft entfremdet. Ihr Haus verfiel; sie leben zwischen Müll und streunenden Katzen, erwarten aber dennoch, dass das Beste noch vor ihnen liegt und bereiten sich jeden Tag auf hochrangige Gäste vor. Umgeben von den Resten ihrer reichen und wilden Vergangenheit, bemühen sich die Frauen, immer noch begehrenswert auszusehen. Sie entfliehen der Realität und legen bei ihrer Kleidungsauswahl und -zusammenstellung große Kreativität an den Tag. Ihr Handeln hat uns tief beeindruckt. Wir wollten, dass jede Figur in „La traviata“ zu einer einzigartigen Collage wird.
Klangplädoyer für die humane Gesellschaft:
Der Musikwissenschaftler Leo Karl Gerhartz zum Sonderfall „La traviata“ in Verdis Schaffen:
In „La traviata“ bricht vor allem die Protagonistin mit alten Konventionen. In ihrer vielregistrigen Stimmskala zwischen virtuoser Koloratur und beweglichem Parlando, lyrischer Empfindsamkeit und dramatischer Expression ist sie das Abbild von einem modernen – das heißt: von überholten Regeln unabhängigen – Menschen. Die inhaltliche Bedeutung dieses musikalischen Sachverhalts kann kaum überschätzt werden. Denn in seiner Suche nach kühnen und einzigartigen Charakteren entscheidet sich Verdi bei seiner Stoffauswahl hier einmal nicht für bizarre Exotik, sondern für eine Außenseiterin in seiner aktuell existierenden Gesellschaft.
Alexandre Dumas‘ Marguerite Gautier – das literarische Vorbild für Violetta Valéry – ist allerdings eine Frau jenseits der abgesegneten bürgerlichen Normen. Mit der Feier einer von eingefahrenen Gleisen
Abgeirrten (tra-viata) werden diese Gleise ganz unmittelbar in Frage gestellt, und es wird deutlich, wie modern ihr Autor über die Rechte und Freiheiten des Einzelnen denkt. Dem Ideal einer glücklichen Gemeinschaft zwischen dem unbescholtenen Bürgerssohn und der bekehrten Halbweltdame steht er schon aus eigener Lebenserfahrung sehr nah. Denn wer wollte leugnen, dass seine zweite Frau Giuseppina Strepponi ebenso wie Violetta durch eine große Liebe zu sich selbst zurückfand oder dass den Kleinstädter Antonio Barezzi, Verdis erster Schwiegervater und in der Jugend unermüdlicher Förderer, ganz ähnliche Sorgen bewegten wie Vater Germont?
Die Tochter des Kapellmeisters Feliciano Strepponi steigt, gefördert von den Theaterunternehmern Lanari und Merelli, bereits als Zwanzigjährige zur großen Primadonna auf. Doch trotz überragender Erfolge hat die Strepponi wenig Grund, sich glücklich zu fühlen. Sie, die nach dem frühen Tod des Vaters für die Mutter und drei jüngere Geschwister zu sorgen hat, zermürbt sich in einem für die Zeit typisch unsteten Sängerinnenleben, das sie von einer fragwürdigen Beziehung zur nächsten treibt. Merelli lässt die Sängerin kurz nach der Geburt im Stich, und als sie auch von Napoleone Moriani, dem berühmten „Tenor des schönen Todes“, ein Kind erwartet, macht er sich ebenfalls aus dem Staub. Erste Anzeichen für ein Nachlassen der Stimmkraft nimmt sie so zum eher willkommenen Anlass für einen frühen Rückzug. Gerade über dreißig, beendet sie ihre Bühnenlaufbahn und lässt sich, einigermaßen verbittert, als Gesangspädagogin in Paris nieder. Hier aber begegnet sie dem Menschen, der ihrem Leben eine entscheidende Wende gibt. Auf seiner ersten größeren Auslandsreise 1847 besucht Verdi zweimal die Mitarbeiterin seiner ersten Erfolge in Paris. Aus einer schon lange währenden Sympathie wird ein Bund fürs Leben.
Alexandre Dumas‘ Marguerite Gautier – das literarische Vorbild für Violetta Valéry – ist allerdings eine Frau jenseits der abgesegneten bürgerlichen Normen. Mit der Feier einer von eingefahrenen Gleisen
Abgeirrten (tra-viata) werden diese Gleise ganz unmittelbar in Frage gestellt, und es wird deutlich, wie modern ihr Autor über die Rechte und Freiheiten des Einzelnen denkt. Dem Ideal einer glücklichen Gemeinschaft zwischen dem unbescholtenen Bürgerssohn und der bekehrten Halbweltdame steht er schon aus eigener Lebenserfahrung sehr nah. Denn wer wollte leugnen, dass seine zweite Frau Giuseppina Strepponi ebenso wie Violetta durch eine große Liebe zu sich selbst zurückfand oder dass den Kleinstädter Antonio Barezzi, Verdis erster Schwiegervater und in der Jugend unermüdlicher Förderer, ganz ähnliche Sorgen bewegten wie Vater Germont?
Die Tochter des Kapellmeisters Feliciano Strepponi steigt, gefördert von den Theaterunternehmern Lanari und Merelli, bereits als Zwanzigjährige zur großen Primadonna auf. Doch trotz überragender Erfolge hat die Strepponi wenig Grund, sich glücklich zu fühlen. Sie, die nach dem frühen Tod des Vaters für die Mutter und drei jüngere Geschwister zu sorgen hat, zermürbt sich in einem für die Zeit typisch unsteten Sängerinnenleben, das sie von einer fragwürdigen Beziehung zur nächsten treibt. Merelli lässt die Sängerin kurz nach der Geburt im Stich, und als sie auch von Napoleone Moriani, dem berühmten „Tenor des schönen Todes“, ein Kind erwartet, macht er sich ebenfalls aus dem Staub. Erste Anzeichen für ein Nachlassen der Stimmkraft nimmt sie so zum eher willkommenen Anlass für einen frühen Rückzug. Gerade über dreißig, beendet sie ihre Bühnenlaufbahn und lässt sich, einigermaßen verbittert, als Gesangspädagogin in Paris nieder. Hier aber begegnet sie dem Menschen, der ihrem Leben eine entscheidende Wende gibt. Auf seiner ersten größeren Auslandsreise 1847 besucht Verdi zweimal die Mitarbeiterin seiner ersten Erfolge in Paris. Aus einer schon lange währenden Sympathie wird ein Bund fürs Leben.
Den gesamten Aufsatz können Sie im gedruckten Programmheft lesen.
Einen weiteren Artikel von Insa Axmann zu den Zusammenhängen zwischen Giuseppina Strepponi und Verdis „La traviata“ sowie aktuelle Aufführungstermine der Oper finden Sie im Online-Auftritt des Magazins Concerti:
It-Girls und ihre Schatten:
Hätte es zu Zeiten von Librettist Francesco Maria Piave schon den Begriff „It-Girl“ gegeben, hätte er Violetta Valéry vielleicht so genannt. Ihre Popularität, die sich zum Teil auch auf ihre geheimnisvolle Aura gründet, wird ihr zugleich zum Verhängnis und erinnert ein wenig an Fälle wie Dianne Brill oder Edie Sedgwick. Im New York Magazine geht Matthew Schneier dem Phänomen It-Girl und ihrer Geschichte seit den 1920er-Jahren bis heute auf den Grund. Seinen Essay finden Sie im gedruckten Programmheft.
Für den SWR blickte die Journalistin Samira Straub auf die neueren Entwicklungen von It-Girls und wie ausgerechnet Social Media dazu beitrug, ein toxisches Frauenbild zurückzudrängen.
Für den SWR blickte die Journalistin Samira Straub auf die neueren Entwicklungen von It-Girls und wie ausgerechnet Social Media dazu beitrug, ein toxisches Frauenbild zurückzudrängen.
Paris Is Burning:
Die Macht der Blicke spielt in Tom Goossens Inszenierung eine wichtige Rolle. Sie wirft Fragen auf wie: Wie sehen uns andere? Inwieweit können wir das kontrollieren? Wann werden wir zum Objekt gemacht und wann werden wir so gesehen, wie wir uns selbst fühlen und identifizieren? Wo geschehen Inszenierungsprozesse unseres Selbst durch uns und durch andere? Wo bleibt unser Verhalten eine oberflächliche Fassade und wo haben wir die Möglichkeit, uns frei auszudrücken und zu zeigen? Im Dokumentarfilm „Paris Is Burning“ von 1990 zeigt Regisseurin Jennie Livingston, wie queere Menschen im New York der 1980er-Jahre Kleidung und Performance als alternative Formen des Selbstausdrucks nutzten, um sich von der Sichtweise anderer zu befreien und ihre eigene Perspektive in die Öffentlichkeit zu tragen.